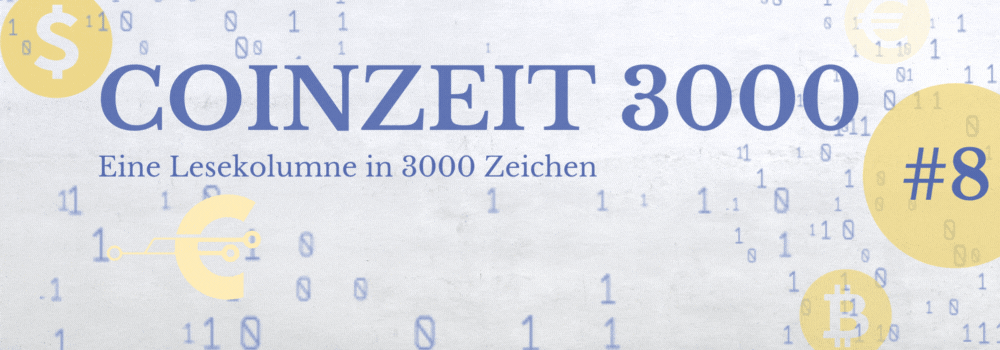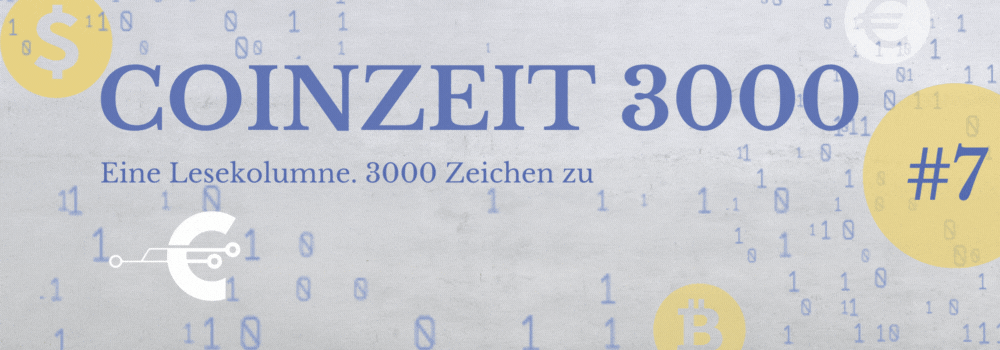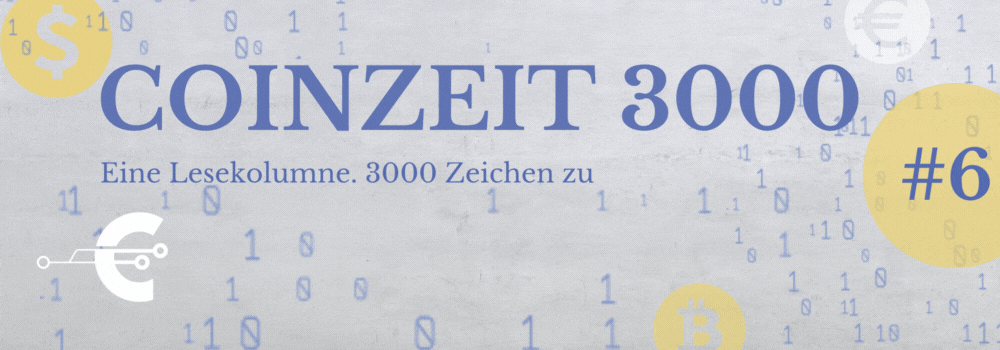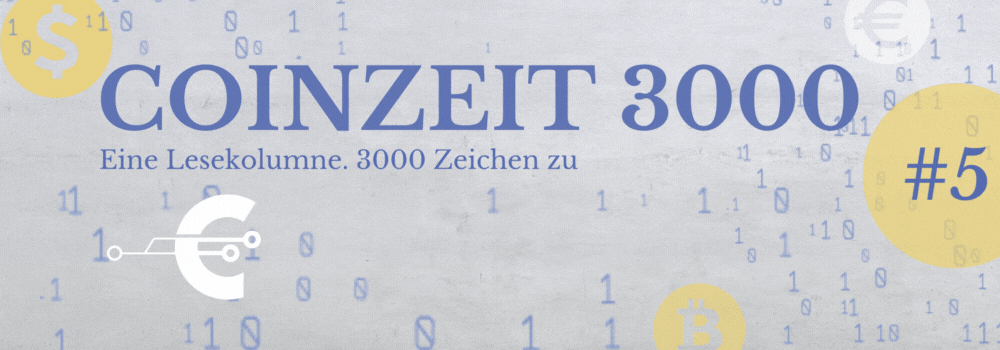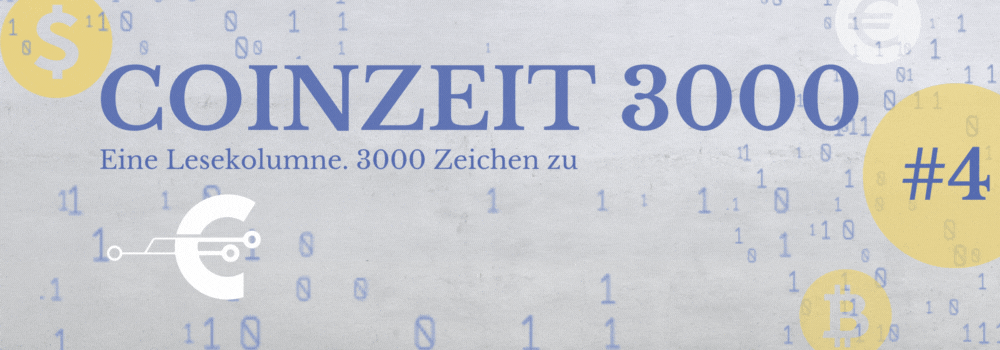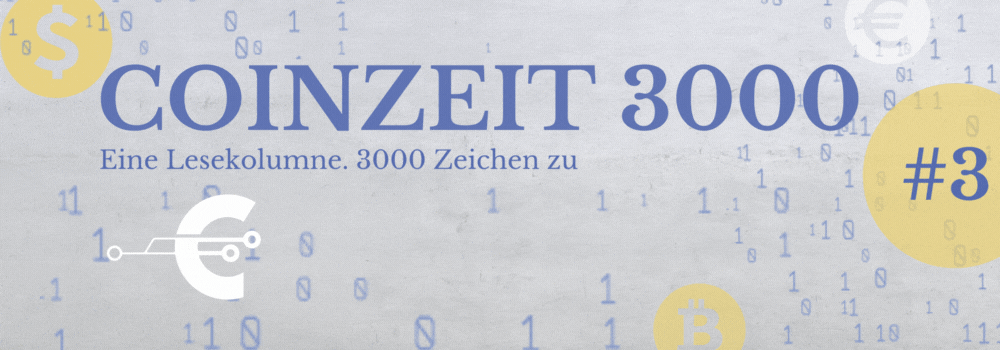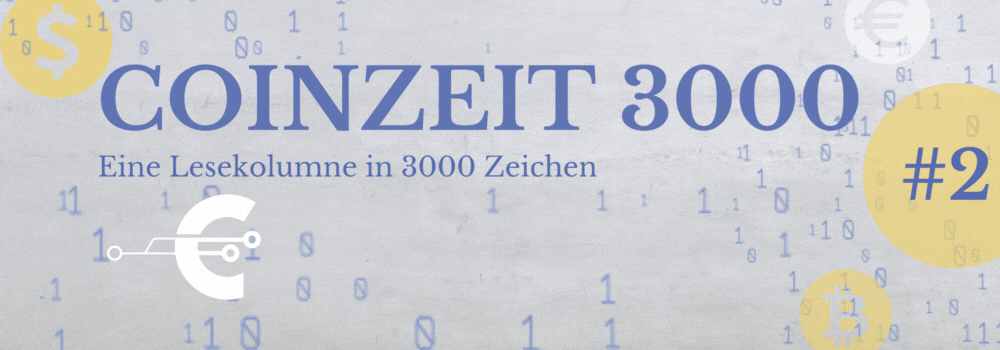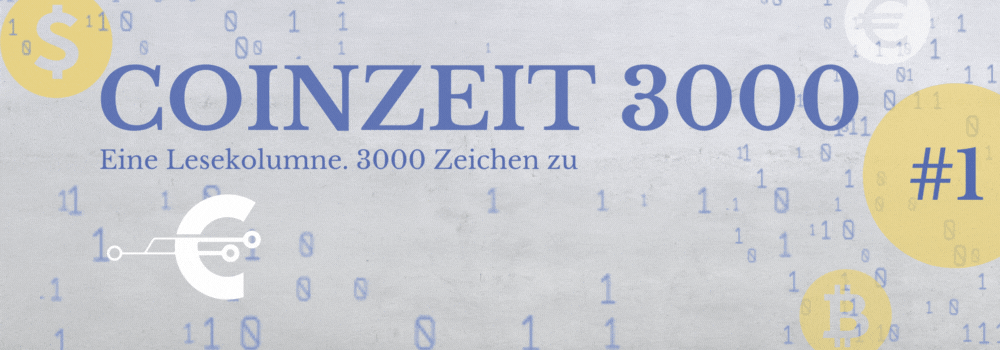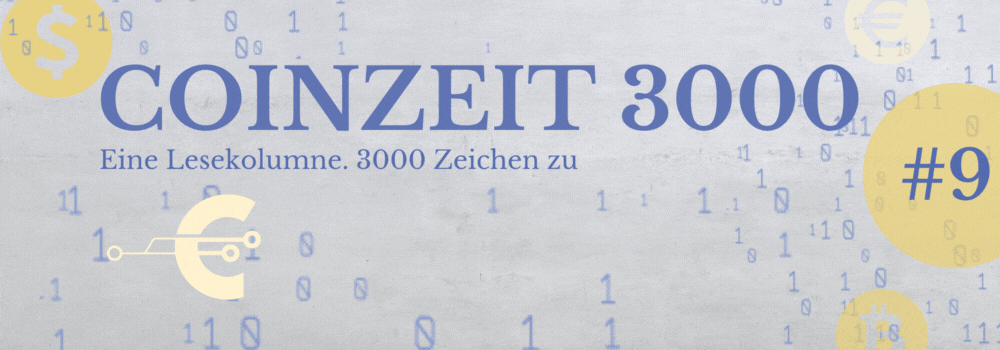
Ein Beitrag von Petra Gehring
25. Juni 2024
Seit zwei Jahren hat die Politikwissenschaft das Thema Geld entdeckt: Geldtheorien werden rekonstruiert, vor allem aber geht es um Gegenwartsdiagnosen. Haben in in den länger zurückliegenden Jahren nicht Politikwissenschaftler, sondern Soziologen wie Urs Stäheli oder Elena Esposito das Bankensystem, die Börse, Spekulationen und Derivate attackiert, so geht es nun um die Frage, ob politische Systeme – und auch gerade moderne Demokratien – „das Geld“ als eine vermeintlich bloß technische Angelegenheit in viel zu starkem Maße den Zentralbanken überlassen. Das Geld werde „zur unpolitischen Technologie verklärt“ (Sahr 2022, Ankündigungstext), demokratische Akteure kümmerten sich zu wenig um „grundlegende demokratische Fragen der monetären Gewalt“ (Eich 2023: 13). Die politische Theorie solle jedoch „dazu beitragen, den unklaren Ort des Geldes in der demokratischen Politik neu zu fassen“ (Eich 2023: 18), in den Blick zu nehmen sei dessen „genuin politische Architektur“ (Sahr 2022: 12).
Die Appelle sind mehr als plausibel – die Finanzkrise, die digitale Umgestaltung der Werte und Wertzeichen hätten dazu eigentlich gar nicht nötig sein sollen. Worüber man aber doch grübelt: Die Forderung der Autoren nach einer „Politisierung“ des Geldes, die konkret in einer Entzauberung der vermeintlichen Neutralität der Zentralbanken zu bestehen hätte, und die dann ohne Wenn und Aber zugleich eine „Demokratisierung“ sein soll. In den Worten von Stefan Eich: „Die Welt braucht dringend eine neue globale monetäre Verfassung und eine Währungsordnung, die demokratischer gesteuert wird.“ (276) Was meint das konkret? Mehr Rechenschaftslegung, mehr Aufsicht, mehr „finanzielle Bürgerrechte“ gegenüber Banken, mehr öffentliche Kreditversorgung, vor allem aber: Zentralbanken sollten „Labore“ werden für eine offene Demokratie. Es gälte, Personen hinein zu wählen, dabei alle gesellschaftlichen Gruppen zu repräsentieren, sie zwar nicht der Exekutive, aber umso mehr den Bürgerinnen und Bürgern zu unterstellen, im Sinne einer eigenständigen monetären Gewalt (vgl. 284).
Dezentral organisierte Kryptowährungen lehnt Eich als „eine Fälschung demokratischen Geldes“, und Plattformwährungen lehnt er als „Vorstoß zu einer Privatisierung des Geldes“ ab (vgl. 277). Das Geld selbst bezeichnet er als „kollektive Fiktion“ (287) und sieht eben darin dann auch das Versprechen der Gestaltbarkeit: „Anstatt uns vom fiktiven Charakter des Geldes blenden oder verängstigen zu lassen, können und sollen wir seine nie vorab festgelegten politischen Potenziale ausschöpfen …“ (287). Möglicherweise falle ich genau hier aus dem Film: Wie kann ich eine kollektive „Fiktion“, ohne sie zu zerstören, kollektiv steuern? In welchem Sinne heißt „fiktiv“ in einem ergebnisoffenen Sinne „unfestgelegt“ (wo wir doch an Fiktionen – als Annahmen, Setzungen, vielleicht sogar Erfindungen – ein Stück weit auch glauben müssen)? Und woher nimmt der demokratische Diskurs den Sinn für die „politischen Potenziale“ einer Fiktion – ohne dass diese Potenziale nicht auch verflixt leicht „fiktiv“ zu nennen wären?
So berechtigt der Hinweis darauf ist, am Geld sei nichts natural, wenig neutral und vieles politisch – Politisierung ist jedenfalls nicht automatisch Demokratisierung. Auch Krypto und Libra „politisieren“ die kollektive Fiktion.
Stefan Eich: Die Währung der Politik. Eine politische Ideengeschichte des Geldes (2022). Hamburg: Hamburger Edition 2023.
Aaron Sahr: Die monetäre Maschine. Eine Kritik der finanziellen Vernunft. München: C.H. Beck 2022.
Zurück zur Startseite des Blogs
Zum Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors