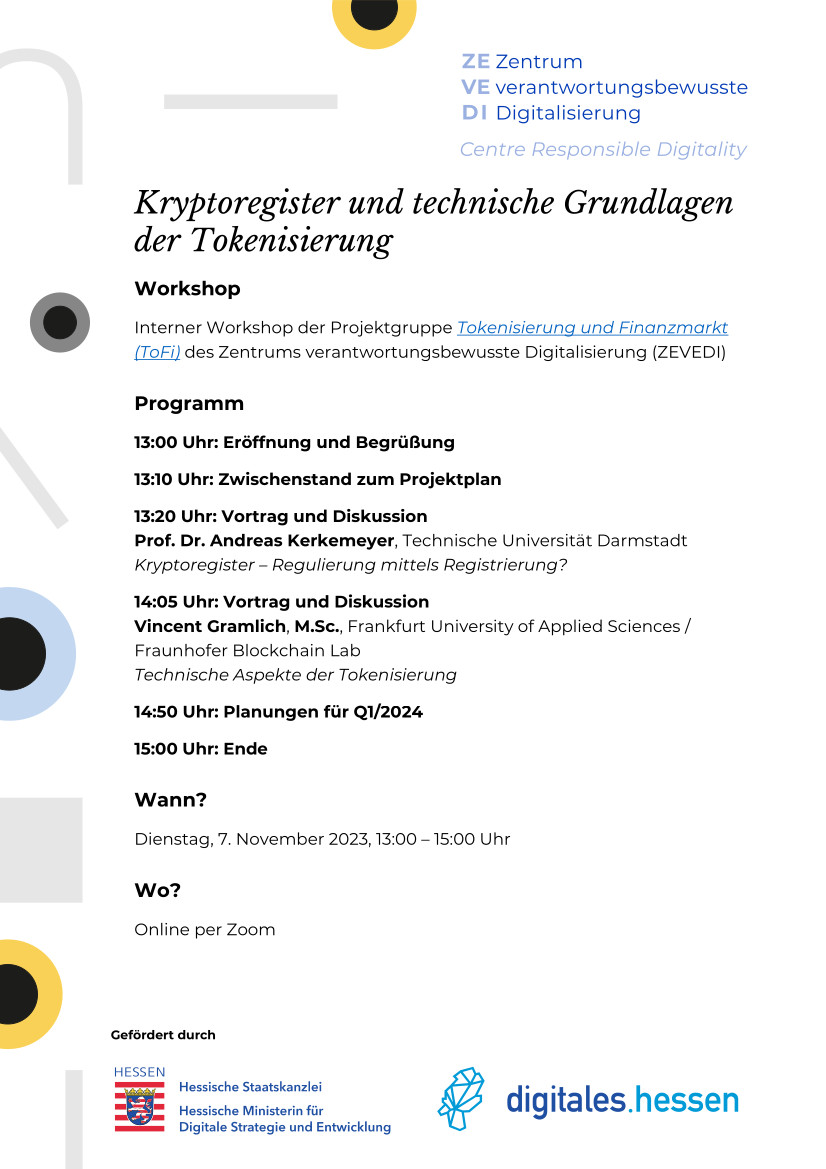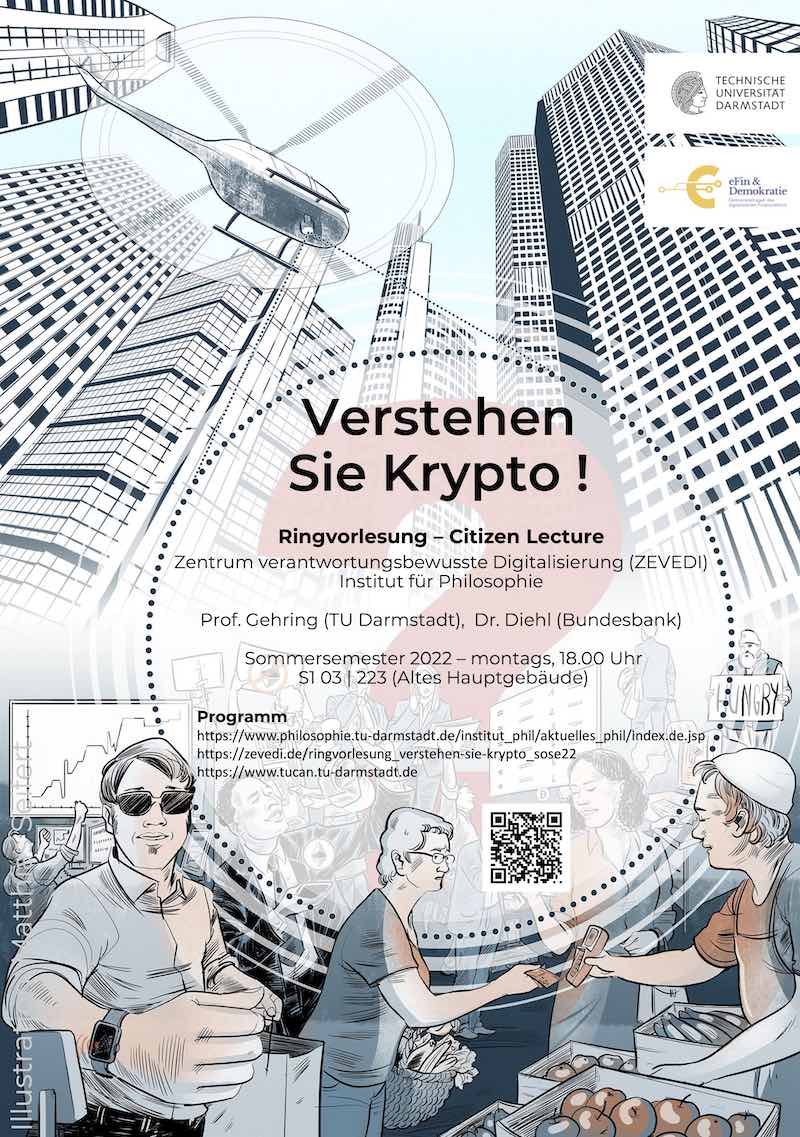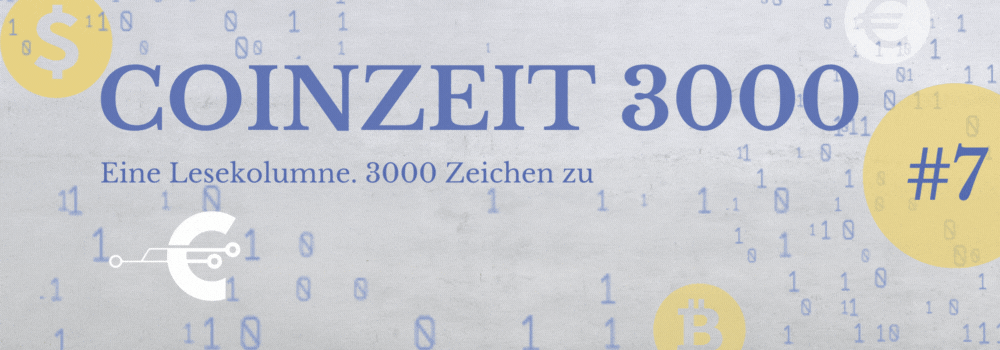
Ein Beitrag von Petra Gehring
15. Februar 2024
Rachel O’Dwyer schreibt als kluge Ethnologin des digitalisierten Bezahl-Alltags. Ihre Umschau zum schillernden „Wert“ nicht nur von Kryptotoken liest sich hinreißend: man ist fasziniert von Vouchern, Giveaways, Amazon-Wishlists, Fortnite-Skins wie überhaupt Gaming-Währungen aller Art, des Weiteren: virtuellen Trophäen, Andenken, Memes – alles das ist informelles Digitalgeld!
„Throughout history, tokens have littered the edges of the economy …” (7). Dieser Ausgangsthese zufolge erscheint offizielles, staatlich abgesichertes und quasi vereindeutigtes Geld geradezu als moderne Ausnahme. Diesseits davon existieren Welten voller Wert-Zeichen, die zirkulieren, temporär in Geltung sind, Käuflichkeit organisieren und Macht verleihen. O‘Dwyer, die am National College of Art and Design in Dublin Digital Culture lehrt, nennt die Träger solcher Wertmarkensysteme (und ihr Buch) Tokens: „As something that is ‘not quite money’, tokens blur the hard edges between legitimate and illegitimate work and legitimate and illegitimate transactions.” (7) Vor der Digitalisierung kannten wir das vereinzelt auch: Rabattmarken, Lebensmittelkarten, Sammelbildchen. Im Netz kommen informelle Bezahlformen nun jedoch in großem Stil zurück: Aus Spiel wird Ernst.
“Tokens confer identity and access.” (10) Digitales Blingbling – nicht Geld, aber money-ish und überall klickbar zu haben sowie spielfigurenartig zu bewegen – ist auch Anerkennungsmittel. Das Wertzeichen kann besagen: Du bist wertvoll, und: Du bekommst genau deshalb, weil du so aussiehst oder dies tust, virtuelles Kapital. Das Spielgeld schafft also vertragsartige Bindungen und steuert: „Tokens can thus […] be a way of attaching special conditions to payments. They can bring spending, eating, parenting, and, well, living in line with the issuer’s objectives. Not just value, then, but values.” (vgl. 10) Ebenso schafft dieses Geld schlimme Belohnungssysteme: physische Demütigungswetten, sadistische “Mutproben”, Online-Sex: „The token is a communication designed to express itself not only with the channel, but immediately and directly on the body of the performer.” (23)
Im Ganzen ist Tokens nicht nur ein cooles, sondern auch ein politisches, zorniges Buch über Geld. Es gibt Kapitel über Tracking durch Geld, über Geld und Identitätsfeststellung, über Code als schlechten Ersatz für Recht und über das Metaverse („Litter is there to create Realism“, 271). Unbedingt lesenswert. Ein einziges Aber: die Begriffswahl. Was alles um Himmels willen nennt O‘Dwyer „Token“? Die Entscheidung für einen Schlüsselbegriff ist sicher immer ein kniffeliger Tauf-Akt. Und sicher ist mein Störgefühl dasjenige einer Philosophin. Token meint aber eben nicht nur Wertzeichen, sondern Zeichen ganz generell. Wären also alle Zeichensysteme letztlich Wertsysteme? Ist das die These: Bedeutung ist (oder wird im Netz) per se Wert?
Zum Einstieg bemerkt O’Dwyer selbst kurz, ihre Verlegerin fände den Begriff zu weit gefasst. Sie räumt ein: Tokens faszinieren als Grenzfall. „A token can be a game, a passcode, a ticket, a social tie, a keepsake, a bribe, a secret message, a gift, a promise, a vote, an ownership stake, a joke, a meme, an art, a flex, a bet, a law, another token.” (11 f.) Die Frage bleibt: Was genau meint more and less than money (11)? Absorbiert die digitale Bezahlfunktion letztlich sogar das Konzept des Zeichens selbst? Oder sprechen wir doch besser dezidiert von Wertzeichen, also von einer zusätzlichen Performance, die – sagen wir: einem digitalen Symbol oder Schriftzug zuwächst, sobald er als bezahlmittelartiger Anreiz Macht gewinnt? Zumindest theoriebegrifflich hieße letzteres: Zwischen „Token I“ (digitales Bezahlen) und „Token II, III, … n“ (Zeichensysteme ohne genau diesen beinahe-Geld-Effekt) wären zu unterscheiden. Auch einen Kapitalismus neuen Typs könnte man wohl nur dann scharf analysieren, wenn man nicht gleich alles im selben Sinne – und sei es ironisch – „Token“ nennt.
Rachel O’Dwyer: Tokens. The Future of Money in the Age of the Platform. London/New York: Verso 2023.
Zurück zur Startseite des Blogs
Zum Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors