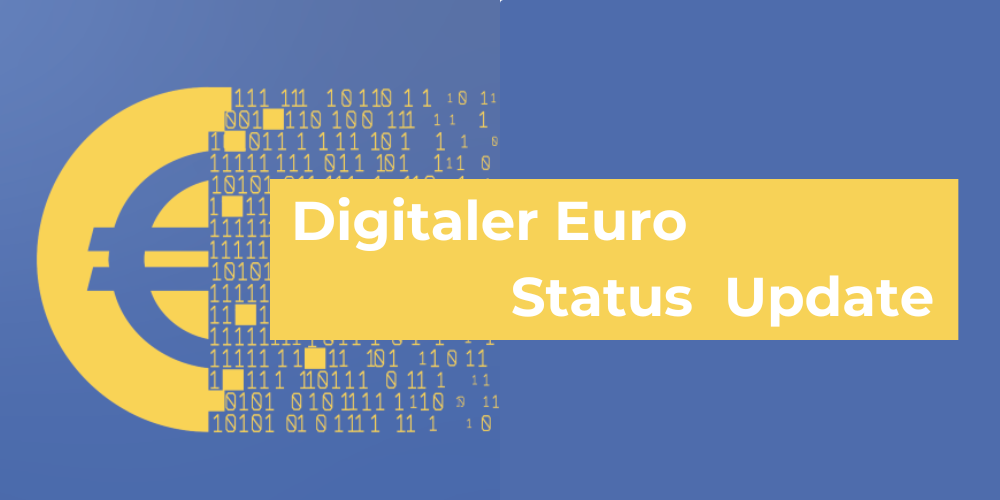Wenn der digitale Euro eingeführt wird, wird er von der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken des Eurosystems bereitgestellt. Die genaue Ausgestaltung dieser digitalen Währung ist jedoch noch Gegenstand intensiver Diskussion und wird voraussichtlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die EZB beschäftigt sich jedoch bereits seit mindestens 2020 mit der Untersuchung einer solchen CBDC oder eben eines digitalen Zentralbankgeldes. Im vergangenen Herbst wurde eine erste Vorbereitungsphase eingeläutet und gewisse Pfadentscheidungen lassen sich mittlerweile ablesen.
In diesem Zusammenhang werfen einige Kritiker der EZB vor, den Interessen der Geschäftsbanken zu sehr entgegenzukommen. Gleichzeitig sind gerade diese Geschäftsbanken diejenigen, die am lautesten warnen und behaupten, dass ein digitaler Euro zu stark in den Zahlungsmarkt eingreifen und ihr Geschäftsmodell gefährden würde. Diese Folge des Digitalgelddickichts wirft daher einen Blick auf das Mandat und die Aufgaben der EZB und erklärt, warum und wie sie bereits am digitalen Euro arbeitet. Im Gespräch mit Jürgen Schaaf, einem Berater der Generaldirektion für Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr der Europäischen Zentralbank, möchten wir herausfinden, wie die EZB beim Projekt „Digitaler Euro“ mit der EU-Gesetzgebung, der Finanzindustrie und der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, inwieweit sie deren Kritik berücksichtigt und was sie ihr entgegnet.
Gäste
Jürgen Schaaf ist seit November 2019 Berater der Generaldirektion des Geschäftsbereichs Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr bei der Europäischen Zentralbank. Zuvor war er Berater des Direktoriums der EZB und Sekretär des Projektteams für den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM). Bevor er zur EZB kam, war er persönlicher Berater des Gouverneurs der Banque Centrale du Luxembourg. Zuvor war er bei der Börsen-Zeitung und als Senior Economist bei der Deutschen Bank tätig. Er hat Wirtschaftswissenschaften in Marburg und Canterbury studiert und an der Philipps-Universität Marburg in Volkswirtschaftslehre promoviert.
Cornelia Manger-Nestler ist Professorin für Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht an der HWTK Leipzig, spezialisiert auf Währungsrecht. Studiert und gearbeitet hat sie zuvor an der TU Dresden und TU Chemnitz, wo sie auch zur Rolle der Deutschen Bundesbank im Europäischen System der Zentralbanken promoviert hat. Sie betreut aktuell zudem, unter anderem ein Forschungsprojekt zu Rechtsfragen des digitalen Euro.
Markus Ferber ist Diplomingenieur, seit 1990 durchgehend Vorstandsmitglied und von 2005 bis 2023 Vorsitzender der CSU Schwaben. Seit 1994 ist er durchgehend Mitglied des Europäischen Parlamentes. Er ist dort Mitglied der EVP–Fraktion, also der Europäischen Volkspartei und seit 2009 auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Zwischen 2014 und 2018 fungierte er als dessen stellvertretender Vorsitzender und seitdem als der Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss. Seit 2020 ist er Vorsitzender der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung.
Henrike Hahn ist Politologin und war als Unternehmensberaterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im bayerischen Landtag und Bundestag tätig. Seit 2012 ist sie aktives Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen Bayern, unter anderem als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen und Vorstandsmitglied. 2019 wurde sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Dort ist sie Vollmitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, sowie stellvertretendes Mitglied im Wirtschafts- und Haushaltsausschuss. Für ihre Fraktion „Die Grünen/EFA“ ist sie Verhandlungsführerin und Schattenberichterstatterin zum digitalen Euro.
Joachim Schuster ist promovierter Politikwissenschaftler und war bis 2006 in der Forschung, im Wissenschaftsmanagement und in der Politikberatung tätig. Seit 1999 für die SPD Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft, war er von 2006 bis 2012 Bremer Staatsrat für Arbeit, Jugend und Soziales sowie später für Gesundheit und Wissenschaft. 2014 zog er ins Europäische Parlament ein. Der S&D-Fraktion zugehörig ist er seit 2019 Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Währung. Im Vorstand der deutschen Sozialdemokrat:innen ist er verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der SPD-Bundestagsfraktion
Weiterführende Informationen und Quellen
Panetta, Fabio: Letter to several MEPs on the request to postpone the decision on the digital euro, 6. Oktober 2023 ( nur in Englisch).
Bollen, Thomas / Fanta, Alexander: Warum die Großbanken Angst vor dem digitalen Euro haben und wie sie gegen ihn lobbyieren, voxeurop Deutsch, 18. April 2024.
Aufzeichnung der Sitzung des EU-Ausschusses für Währung und Wirtschaft (ECON) zum Digitalen Euro mit Piero Cipollone, Direktoriumsmitglied der EZB, vom Nachmittag des 14. Februar 2024.
Empfehlung für Überblicksinformation zum digitalen Euro seitens der EZB: Häufig gestellte Fragen zum digitalen Euro, EZB-Webseite (abgerufen am 29. April 2024).
Alle Folgen des Digitalgelddickichts»