Von eingefrorenen Konten und ungleichen Bedingungen im internationalen Zahlungsverkehr
Alexandra Keiner im Interview mit Caroline Marburger
2. November 2023
Alexandra Keiner ist Soziologin und forscht als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Weizenbaum-Institut Berlin zu Finanzinfrastrukturen, Plattformökonomie und Regulierung von Internetpornographie. Beim von ZEVEDI in Kooperation mit dem Mousonturm Frankfurt veranstalteten Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen mit dem Titel Follow the Money. Von analogen Werten, digitalem Geld und der Bezifferung der Welt war sie als Expertin für Bezahlverbote dabei. Caroline Marburger von eFin & Demokratie hat mit ihr über ihre Forschung geredet und darüber, wie sie diesen Abend und die 1:1-Gespräche mit Nichtexpert:innen wahrgenommen hat.

Frau Keiner, wie sind Sie eigentlich auf Ihr Thema „Bezahlverbote im Netz“ gekommen und mit welchen Fragen befassen Sie sich in Ihrer Forschung?
Meine Abschlussarbeit habe ich über die staatliche und private Regulierung von Pornographie im Internet geschrieben. Darüber, wie eine Art Zweiteilung des kommerziellen Internets entstanden ist: Auf der einen Seite stehen Big-Tech-Unternehmen, die die Darstellung pornografischer und sexueller Inhalte zunehmend einschränken. Und auf der anderen Seite die Internet-Pornographie-Industrie, wo eine starke Machtkonzentration zugunsten der großen Pornographie-Plattformen zu beobachten ist.
Und dann wurde mir schnell klar, welche wichtige Rolle Zahlungsdienstleister im Netz spielen – und zwar für beide Seiten. Daraus ergab sich für mich eine breitere und intensivere Auseinandersetzung mit Fragen der Rolle von Zahlungsinfrastrukturen und finanzieller Inklusion: Wer wird warum und wie von der Nutzung bestehender, insbesondere grenzüberschreitender Zahlungsinfrastrukturen ausgeschlossen? Inzwischen untersuche ich dies insbesondere am Beispiel der Digitalisierung von Auslandsüberweisungen.
Wie können wir uns das denn konkret vorstellen? Haben Sie ein Beispiel für Ausschlussverfahren durch Zahlungsdienstleister, die Sie aus Ihrer Forschung kennen?
Zum Beispiel bei der Internetpornographie, wo viele Performer:innen in Lateinamerika leben, aber ihre Kund:innen in Europa oder den USA: Die Performer:innen sammeln ihre Einkünfte, die sie meist über Plattformen erwirtschaften, meist auf ihrem Paypal-Account. Erfahrungsberichte in Interviews, Studien oder Social Media Posts, die sich mit dem Konsum und dementsprechendem Bezahlen von pornografischen Inhalten im Netz beschäftigen, zeigen: Meist ist Paypal die komfortabelste Option oder sogar die einzige Option, die die Plattformen überhaupt anbieten. Außerdem sind Brasilien, Bolivien, Argentinien zum Teil Länder mit unglaublich hoher Inflation. Anbieter:innen von dort haben also gute Gründe, die Zahlungen, die sie in Euro oder Dollar erhalten, als Paypal-Guthaben auf ihrem Account liegen zu lassen.
Paypal hat 2019 beschlossen, die Zahlungen auf einer der größten Porno-Plattformen einzustellen. Aber die Frage ist: Für wen gilt das? Wenn ich jetzt dort bei Pornhub ein Premiumkonto habe, dann wird mein Paypal-Konto nicht gesperrt. So ein Konto bleibt natürlich unangetastet, die Konsument:innen bleiben unbelangt. Der einzige Nachteil ist, dass Paypal auf dieser Plattform nicht mehr als Zahlungsoption zur Verfügung steht.
Aber auch das Konto der betreibenden Unternehmen bleibt unberührt. Pornhub bzw. das dahinterliegende Unternehmen Mindgeek sagt, sie seien nur eine Werbe- oder Datenplattform. Die Werbetreibenden wiederum sagen, sie würden nur Werbung schalten. Die Einzigen, die davon betroffen sind und ihr Geld nicht bekommen, sind Hunderttausende von Performer:innen oder Produzent:innen, weil dort, so die Aussage, die Situation klar sei. Die verdienen ihr Geld zu 100 Prozent mit Pornographie, die anderen nicht.
Ihr Paypal-Konto mit, sagen wir, 5000 Euro, wird eingefroren. Die Darsteller:innen haben dann vorerst keinen Zugang mehr. Gemäß der AGB ist Paypal zu solchen Maßnahmen berechtigt. Wie Performer:innen bezahlt werden oder ob sie überhaupt bezahlt werden, wird immer undurchsichtiger und trotzdem läuft das Geschäft natürlich weiter, nur die Bezahlung wird schwieriger.
Was wird von Zahlungsdienstleistern denn konkret reguliert?
Im beschriebenen Fall verwies Paypal auf seine AGBs, wonach Zahlungen für sexuell orientierte Produkte und Dienstleistungen untersagt werden können. Sie geben in ihren AGBs auch an, dass sie Zahlungen von terroristischen Organisationen oder extremistischen Gruppen verbieten.
Die Frage bleibt aber: Was tun sie konkret? Denn sie müssen ihr Handeln nicht im Einzelfall begründen. Daher ist es schwierig nachzuweisen, wo genau die Mechanismen greifen. Gerichtsurteile und vorliegende Studien zeigen aber, dass die bestehenden Mechanismen letztlich dafür sorgen, dass eher linke als rechte Gruppen, eher kleine als große Unternehmen, eher Frauen als Männer, mehr im globalen Süden betroffen sind – mehr als etwa rechte Organisationen in den USA.
Gibt es denn eine Kooperation zwischen Zahlungsdienstleistern und staatlichen Stellen?
Um nicht (noch) stärker reguliert zu werden, arbeiten Zahlungsdienstleister auch über die normale Gesetzeslage hinaus vermehrt mit Staaten zusammen. Die kanadische Soziologin Natasha Tusikov nennt diese Abmachungen handshake deals. Das kann zum Beispiel heißen: Das US-Markenrecht soll weltweit eingehalten werden, also wird eine entsprechende „Schwarze Liste“ erstellt. Kommt bei Transaktionen ein Name von dieser Liste vor, also zum Beispiel ein Name, hinter dem der Verkauf von Raubkopien vermutet wird, dann werden diese Transaktionen automatisch ohne Überprüfung unterbunden. Auch wenn die Betroffenen nicht der US-Gesetzgebung unterliegen.
Es kann auch sein, dass bestimmte Wörter in Transaktionen ausreichen, um zum Problem zu werden. Zum Beispiel Aleppo-Seife. Potenzielle Käufer:innen dieser Seife können, da hier versucht wird, Terrorfinanzierung zu verhindern, in einem normalen Onlineshop nicht mehr mit Paypal bezahlen.
Sie verstehen also bei aller Kritik den Erfolg von Paypal? Und meinen Sie, man sollte es nutzen?
Es ist klar, dass es so erfolgreich ist, weil es im Vergleich einfach, schnell und teilweise günstig ist. Wenn man dem Problem mit dem Vorwurf begegnet „Was nutzt du denn auch Paypal?“, oder es boykottiert, dann wird das Problem wieder individualisiert. Du benutzt deren Dienste eben, weil es einfach ist und weil es viele Möglichkeiten bietet, die es vorher nicht gab, aber die es geben sollte.
Sie befassen sich derzeit mit dem Phänomen der Rücküberweisungen oder „remittances“ auf Englisch , also damit, dass Menschen entweder in ihre Herkunftsländer oder an Familienmitglieder im Ausland Teil ihres Lohnes überweisen – meist in vergleichsweise ärmere Länder. Diese Überweisungen gelten als ein Kernbestandteil des globalen Finanzsystems, zumal ihr Volumen das humanitärer Hilfe für Schwellen- und Entwicklungsländer übersteigt. Man geht davon aus, dass diese Finanzflüsse wesentlich zu Stabilität und Wachstum der Länder beitragen, in die diese Gelder fließen. Wie verbindet sich dieses Feld mit dem, was Sie bisher erforscht und wir besprochen haben?
Ich hatte aus meiner bisherigen Forschung die Erkenntnis mitgenommen, dass die Einschränkungen und Probleme von Zahlungsinfrastukturen bestimmte Personengruppen mehr als andere betreffen. Und dann bin ich auf Western Union aufmerksam geworden. Ich habe mich gefragt, warum zum Beispiel in Berlin-Mitte immer noch Menschen Schlange stehen, um Geld für ihre Verwandten im Ausland aufzugeben. Ändert sich hier etwas durch die Digitalisierung? Digitalisieren sich auch Unternehmen wie Western Union? Und was hat das dann für eine Bedeutung, wenn sich die Macht über diese Rücküberweisungen in so wenigen Unternehmen konzentriert? Was bedeutet es gesellschaftlich, dass es eine gänzlich parallele Infrastruktur gibt, deretwegen bestimmte Menschen mit horrend hohen Gebühren Geld zur Unterstützung ihrer Familien ins Ausland schicken, während deutsche Bürger:innen ohne Migrationsgeschichte dies kaum kennen, da sie selbst zumindest in den meisten Fällen so gut wie gebührenfrei überweisen.
Kommt für diese Auslandsüberweisungen eigentlich auch Paypal in Frage? Oder Kryptowährungen?
Paypal, ja, teilweise, sofern man ein Bankkonto hat. Das haben viele der Empfänger:innen der Rücküberweisungen nicht. Es gibt auch Länder die gänzlich ausgeschlossen sind, wie Iran, Nordkorea und derzeit Russland. Überweisungen via Paypal können aber je nach Wechselkurs und Zielland sehr teuer sein. Auch beim Währungsumtausch erhebt Paypal ggf. hohe Gebühren und zudem tauscht es das Geld der Sender:innen zu schlechteren Wechselkursen um.
Das gilt auch für Western Union: Nach dem Erdbeben in Marokko warben sie damit, dass die Überweisungen für ein paar Wochen gebührenfrei wären. Aber diese Werbung war mit Sternchen versehen und nahm die Währungsumrechnung davon aus. Ihr Verdienst liegt schließlich neben den Gebühren in der sogenannten Wechselmarge, also der Differenz zwischen dem von ihnen angebotenen und dem aktuellen Marktkurs. Letztlich werden so mit einer Aktion, die immer noch Verdienst erlaubt, ggf. ganz neue Kunden gewonnen – eben die, die den Opfern finanzielle Hilfe zukommen lassen wollen.
Krypto kann teilweise eine Option sein, aber dafür muss man sich mit der Infrastruktur auskennen und es ist nicht immer gebührenfrei. Wenn ich jetzt beispielsweise meinem Opa in Rumänien Geld schicken wollen würde: Er würde es mit Krypto nicht hinbekommen. Das heißt, vereinzelt ja, aber da ist die Schwelle recht hoch. Ich halte das noch nicht für eine gangbare Option.
Warum, meinen Sie, wird bei aller Kritik an Internetplattformen so wenig über die Zahlungsdienstleister im Netz diskutiert? Was genau beim digitalen Bezahlen passiert, ist eigentlich nie Thema. Ist das wirklich zu schwierig? Oder nutzen wir es schlicht, weil es so schön einfach ist und denken gar nicht drüber nach? Sind wir da gutgläubig?
Ich glaube, es ist auch nicht zu unterschätzen, dass es den Anschein einer rein technologischen Lösung hat: eine App, die wir schlicht als Lösung eines früheren Problems akzeptieren, oft ohne größere Fragen zu stellen. Das war kompliziert, hat früher mehrere Tage gedauert und was gekostet. Und jetzt plötzlich geht es ganz schnell und kostet kaum was. Toll, dass die Digitalisierung das geschafft hat. Nehme ich. Muss es doch auch für alle geben.
Über diese Forschungsthemen bzw. konkreter das Thema Bezahlverbote haben Sie mit Laien in einem Tischgespräch auf dem Markt des nützlichen Wissens und Nicht-Wissens» gesprochen. Ein Gespräch, das ihre Gegenüber am Marktschalter für einen Euro gebucht hatten. Titel dieses Marktes war „Follow the Money“. Könnten Sie schildern, wie Sie den Abend wahrgenommen haben?

Du wirst eingelassen und dann erfasst es Dich. Es ist zum einen echt, wirkt authentisch, eben ein vielstimmiges Gespräch zahlreicher Expert:innen und ihrer Gegenüber. Gleichzeitig ist aber auch ein performiertes Marktgeschehen. Diese Mischung war unglaublich spannend.
Durch das Programm zu gehen und so viele Leute zu sehen, die sich dafür interessieren, das war schön. Ich gebe zu, ich war ein wenig besorgt, meine Gesprächspartner:innen zu enttäuschen. Schließlich gab es so viele spannende Themen. Der Experte am Nachbarstisch kann buchstäblich zaubern – und ich erzähle was vom Zahlungsverkehr.
Stimmt, das ist harte Konkurrenz. Aber diese Sorge hat sich schließlich gelegt, oder?
Man denkt kurz: Habe ich überhaupt was zu erzählen? Was könnte ich sagen? Aber die Gespräche waren dann sehr angenehm und kurzweilig.Meine Gesprächspartnerinnen waren beide aus der Kreativszene, keine, die irgendwie 3.000 € im Monat auf ihr Konto bekommen, sondern eben auch Minusstände kennen. Und bei einer gab es die Angst, dass irgendwann die Existenz unsicher wird. Was, wenn ihre Kunst plötzlich als problematisch oder pornografisch gilt und kein Geld mehr fließt. Welche Umstände könnten ggf. dazu führen, dass man selber ins Hintertreffen gerät?
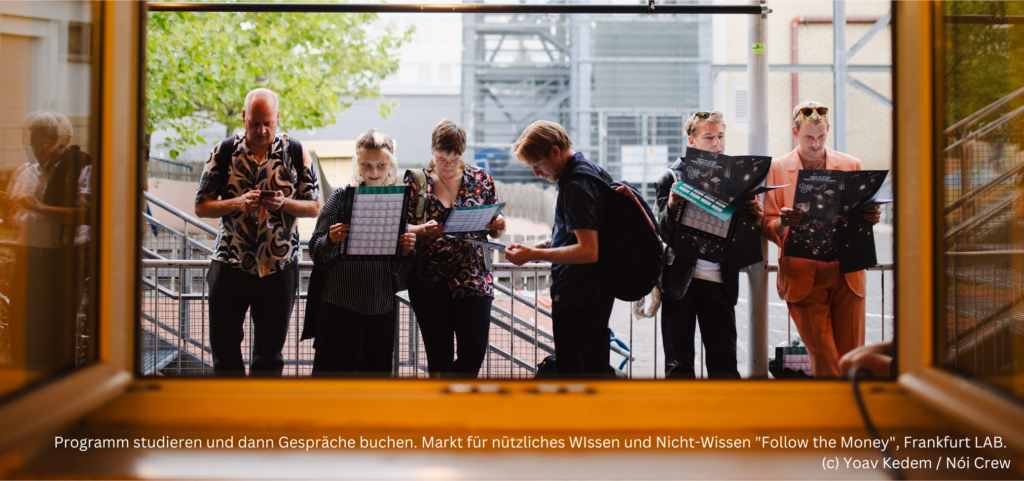
Welche Frage oder Ansicht hat Sie ggf. überrascht?
Besonders überrascht hat mich die Frage, warum die Staaten nicht in die Macht der großen Finanzakteure eingreifen, auch wenn diese international agieren. Eine andere Frage war, warum es überhaupt rechtlich möglich sei, Menschen einfach von Finanzdienstleistungen auszuschließen. Es müsse doch so etwas wie ein Grundrecht auf (internationalen) Geldtransfer geben.
Hat es Sie im allerersten Moment nicht vielleicht auch überrascht, dass Paypal so einfach Zahlungen unterbinden kann?
Doch, mir ging es auch so, aber in der letzten Zeit habe ich mich weit davon entfernt. So dass ich jetzt dachte, es sei merkwürdig, dass Bürger:innen davon ausgehen, man habe generell sowas wie ein Recht auf ein Bankkonto oder ein Recht auf Bezahlung.
Ich finde auch zunehmend, dass wir das in der Schule lernen sollten. Ich habe ja Sozialwissenschaften studiert und nicht Ökonomie. Und als ich zu diesem Thema gekommen bin, hatte ich erstmal wenig Ahnung und das fühlt sich ungut an. Man denkt: Bin ich naiv? Warum weiß ich das nicht? Aber letztlich scheint es mir strukturell bedingt, dass man so wenig weiß über so eine wichtige Infrastruktur oder darüber, wie eigentlich Banken und Geldschöpfung funktionieren.
Sie sagen, es sei strukturell bedingt. Was glauben Sie, sind die Ursachen? Haben Sie eine Hypothese?
Ich glaube ich habe zwei Antworten. Die eine wäre offiziell und die andere, sehr zugespitzt, was ich selber denke.
Ich fange mal mit der Offiziellen an. Man könnte es als eine Art Abkopplung beschreiben. In dem Moment, als das Geldsystem überhaupt sich tiefgreifend verändert hat. Der Finanzmarkt wurde beispielsweise mit dem Big Bang von 1986 in London sukzessive dereguliert und in England und den USA eröffneten sich völlig neue Dimensionen– eine Welle, dem auch der streng regulierte Finanzmarkt Deutschlands sich als Exportnation nicht gänzlich entziehen konnte. Der Finanzmarkt wurde komplizierter, aber auch schneller und größer. Und gleichzeitig sollten, glaube ich, die Leute nicht zu sehr verwirrt werden. Es gibt im Buch „Zentralbankkapitalismus“ von Joshua Wullweber ein Vorwort von Rainer Voss, einem ehemaligen Investmentbanker und inzwischen Befürworter einer gerechteren Finanzpolitik, in dem sagt er sinngemäß zur Entwicklung seit den 80er Jahren: „Da haben wir als Banker einfach die Tür zugemacht und gesagt, nee, wir wollen auch gar nicht, dass das jemand en detail versteht“.
Zugespitzt würde ich zudem sagen, dass gewisse Gruppen bei der vehementen Ungleichheit, die existiert, vielleicht nicht unbedingt wollen, dass alle sich im Klaren darüber sind, wie viel Macht Banken eigentlich haben, indem sie Geld schöpfen, und wie unsicher Geld sein kann.
Gab es Aspekte ihres Themas, die nicht vorgekommen sind, aber die Sie persönlich auch spannend gefunden hätten?
Die geopolitischen Aspekte dahinter, gerade heute. Zum Teil ist die Infrastruktur durch Krisen, Konflikte und Krisen fragmentierter. Man kann kein Geld mehr gen Russland senden. Das kann man natürlich angesichts des Angriffskriegs verstehen und gutheißen. Aber es gibt zahlreiche Menschen, die im Ausland arbeiten und ihrer Familie in Russland kein Geld mehr schicken können. Oder Arbeitsmigrant:innen in Russland, die ihren Familien in Moldawien und Kasachstan kein Geld mehr schicken können. Oder humanitäre Organisationen, die kein Geld mehr bekommen. Für Arbeitsmigrant:innen mit geringem Einkommen bedeutet das höhere Kosten und unsichere Wege, während Oligarchen und Menschen mit mehr Ressourcen und besseren Netzwerken viel leichter alternative Wege finden.
Und was haben Sie als Expertin aus dem Gespräch mit jemandem, der kein Vorwissen hat, mitgenommen? Lernt man selber etwas?
Ja, auf jeden Fall. Was mir schönerweise durch diese Gespräche ganz stark bewusst geworden ist: die Relevanz des Themas. Ich glaube bis zu diesen beiden Gesprächen war ich mir nur im Abstrakten darüber im Klaren. Aber es ist ein relevantes Thema, wie dieser Zugang zu Zahlungsinfrastrukturen vergeben oder auch wieder genommen wird. Vielleicht geht es weniger um staatliche vs. private Akteure, sondern darum: Wer hat Zugang und wie wird er beherrscht oder reguliert? Und was können wir ggf. dagegen tun?
Es gibt ja in Sachen Finanzdienstleistungen selten kollektive Empörung. Aber ich habe die Empörung bei den Gesprächspartnerinnen gemerkt „Wie, ich kann nichts machen? Dann beschwere ich mich doch wenigstens bei meiner Bank!“. Aber die Bank hat auch nur einen Vertrag mit entweder Visa oder Mastercard. Mir ist deutlich geworden, dass beiden, die keineswegs naiv waren, sobald sie sich das Thema vor Augen geführt haben, das Potenzial von Zahlungsinfrastrukturen bewusst wurde: die gesellschaftlichen Chancen wie auch die Risiken.
Ich habe dazugelernt, dass es nicht stimmt, dass die Leute sich nicht dafür interessieren oder die Problematik nicht sehen. Die Fragen, die gestellt wurden, waren eigentlich sozial- oder politikwissenschaftliche Fragen. Und leicht hat man das Gefühl, man arbeite an etwas, für das sich niemand interessiert. Schließlich sind Finanzinfrastrukturen ein absolutes Nischenthema in der (Wirtschafts)Soziologie. Oft wird abgewinkt, weil man befürchtet, es sei schwer nachvollziehbar. Daher war es für mich ganz wichtig zu merken, dass es Relevanz hat, sich doch ein paar mehr mit diesen Themen befassen und es eben auch ein Publikum dafür gibt. Es hat für mich wie eine Art Empowerment gewirkt, auch andere Frauen zu sehen, die Wissenschaftler:innen und Expert:innen sind, auch aus anderen Disziplinen und aus dem globalen Süden.
Was nehmen Sie also mit?
Dass man reden muss. Auch gar nicht im Sinne von Aufklärung. Mangelnde Financial Literacy bzw. finanzielle Kompetenz ist nicht das einzige Problem. Es geht weniger oder nicht nur darum, wie Leute mit ihrem Geld umgehen, sondern DIESE Art von Gesprächen zu haben, die beide auf eine andere Ebene bringen und aus denen sich wichtige Fragen ergeben. Keine Begegnung der Art: Ich habe Ahnung, du hast keine und ich erkläre das jetzt mal. Das Gefühl hatte ich an dem Abend nicht und als ich die anderen beobachtet habe, schien mir das auch nicht so zu sein.
Sie haben es selber sehr schön gesagt: Es geht ja gar nicht um Aufklärung von oben nach unten. Aber wo anfangen, wo sehen Sie besonders viel Veränderungsnotwendigkeit oder -potenzial?
Ich würde mir nach wie vor wünschen, es würde in den Sozialwissenschaften weniger Nischenthema sein. Und wie bereits gesagt, fände ich es unglaublich wichtig, dass schon in der Schule thematisiert wird, wie etwa eine Bank funktioniert. Dass man sehr früh anfängt und idealerweise eine Selbstsicherheit bei Jugendlichen und Bürger:innen erzeugt, zu sagen: „Ich weiß zumindest diese Grundsätze. Dann kann ich vielleicht auch die Nachrichten und die Zeitung besser verstehen, und das auch als für mich relevant wahrnehmen.“ Das Problem dabei ist gar nicht die Komplexität, sondern wie man das rüberbringt.
Zurück zur Startseite des Blogs»
Zum Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors»

